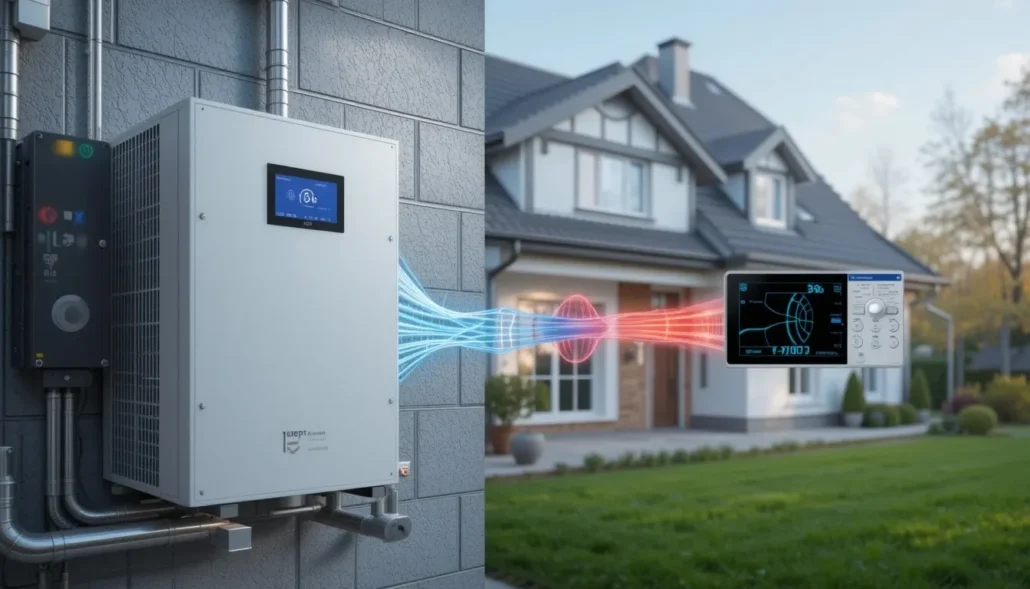Effizienz von Wärmepumpen verstehen: COP, SCOP und Jahresarbeitszahl
Bei der Bewertung von Wärmepumpen spielt die Effizienz eine zentrale Rolle. Häufig werden Begriffe wie COP, SCOP und Jahresarbeitszahl verwendet, die jedoch oft verwechselt oder missverständlich interpretiert werden. Um Wärmepumpen fundiert bewerten zu können und nicht unbeabsichtigt Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist es wichtig, diese Kennzahlen und ihre Unterschiede genau zu verstehen.
COP – Coefficient of Performance (Leistungszahl)
Der Coefficient of Performance (COP), zu Deutsch Leistungszahl, beschreibt das auf einem Prüfstand ermittelte Verhältnis der erzeugten Heiz- oder Wärmeleistung zur eingesetzten elektrischen Leistung. Diese Kennzahl wird genutzt, um die Effizienz verschiedener Wärmepumpen miteinander vergleichen zu können.
Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:
COP = Wärmeleistung (in Watt) / Elektrische Leistung (in Watt)
Wichtig zu verstehen ist, dass der COP kein konstanter Wert ist, sondern maßgeblich vom sogenannten Temperaturhub abhängt.
Der Temperaturhub und sein Einfluss auf die Effizienz
Der Temperaturhub bezeichnet den Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle (Luft, Erdreich oder Grundwasser) und der Vorlauftemperatur der Heizungsanlage. Dieser Temperaturunterschied hat erheblichen Einfluss auf die Effizienz der Wärmepumpe.
Ein anschaulicher Vergleich: Der Transport einer Getränkekiste vom Hauseingang in eine Wohnung im Erdgeschoss erfordert weniger Energie als der Transport in den dritten Stock. Am Ende steht jedoch in beiden Wohnungen nur eine Kiste. Ähnlich verhält es sich bei Wärmepumpen: Mit jedem zusätzlichen Grad Temperaturhub benötigt die Wärmepumpe mehr Strom, und die Energieeffizienz reduziert sich durchschnittlich um etwa 2,5%.
Diese Faustregel bedeutet, dass 10°C weniger Temperaturhub zu etwa 25% höherer Anlageneffizienz führen. Je geringer der Temperaturhub, desto größer ist also auch die Leistungszahl (COP).
Betriebspunkte verschiedener Wärmepumpentypen
Um die Effizienz verschiedener Wärmepumpen vergleichen zu können, wurden standardisierte Betriebspunkte definiert, unter denen der COP auf dem Prüfstand ermittelt wird:
| Wärmepumpentyp | Betriebspunkt | Quellentemperatur | Vorlauftemperatur | Temperaturhub |
|---|---|---|---|---|
| Luftwärmepumpe | A2/W35 | 2°C | 35°C | 33 K |
| Erdreichwärmepumpe | B0/W35 | 0°C | 35°C | 35 K |
| Grundwasserwärmepumpe | W10/W35 | 10°C | 35°C | 25 K |
| Luftwärmepumpe (Alternative) | A-7/W55 | -7°C | 55°C | 62 K |
Wichtig zu beachten ist, dass Wärmepumpen mit unterschiedlichen Wärmequellen nur bedingt miteinander verglichen werden können, da sie unterschiedliche Betriebspunkte und damit verschiedene Temperaturhübe aufweisen. Ein objektiver Vergleich ist nur zwischen Wärmepumpen mit gleicher Wärmequelle möglich.
Die für die COP-Ermittlung verwendeten Betriebspunkte gehen von einer Vorlauftemperatur von 35°C aus, was für Neubauten realistisch sein mag, für Bestandsgebäude jedoch oft zu niedrig angesetzt ist. Dadurch entstehen für Bestandsgebäude häufig zu optimistische COP-Werte.
Viele Hersteller geben daher zusätzlich auch COP-Werte für weitere Betriebspunkte an, z.B. A-7/W55 (Außentemperatur -7°C, Vorlauftemperatur 55°C), die einen Temperaturhub von 62 Kelvin und damit deutlich niedrigere COP-Werte aufweisen.
SCOP – Seasonal Coefficient of Performance (Saisonale Leistungszahl)
Da der COP nur eine Momentaufnahme der Effizienz unter spezifischen Bedingungen darstellt, wurde die saisonale Leistungszahl (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP) eingeführt. Der SCOP berücksichtigt nicht nur einen einzelnen Betriebspunkt, sondern eine Reihe von definierten Betriebspunkten und Temperaturhüben, um den realen Bedingungen im Jahresverlauf näher zu kommen.
Obwohl der SCOP ein besseres Bild der zu erwartenden Effizienz liefert als der COP, liegt er dennoch häufig deutlich über den tatsächlich in der Praxis erreichten Werten. Für Luftwärmepumpen werden teilweise SCOP-Werte von über 6,0 angegeben, was die aus der Praxis bekannten Arbeitszahlen bei weitem übersteigt. Der Grund dafür ist, dass die berücksichtigten Betriebspunkte insbesondere für Bestandsgebäude zu optimistisch gewichtet werden.
COP und SCOP: Nützlich, aber mit Einschränkungen
COP und SCOP sind nützliche Instrumente, um die Effizienz verschiedener Wärmepumpen beim Kauf zu vergleichen – ähnlich wie der genormte Spritverbrauch beim Autokauf. Allerdings wissen wir alle, dass der tatsächliche Spritverbrauch im Fahralltag oft deutlich von den Angaben in den Prospekten abweicht.
Um den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln, muss man die konkrete Verbrauchsmenge durch die erbrachte Leistung teilen – beim Auto die Tankfüllung durch die gefahrenen Kilometer, bei der Wärmepumpe den Stromverbrauch durch die erzeugte Wärmemenge. Und genau hier kommt die Jahresarbeitszahl ins Spiel.
JAZ – Die Jahresarbeitszahl
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) bezeichnet das Verhältnis der von einer Wärmepumpe über ein vollständiges Jahr erzeugten Wärmemenge bezogen auf die für den Betrieb der Anlage aufgewendete Strommenge. Im Gegensatz zur Leistungszahl (COP) wird nicht nur die Leistung in einem Betriebspunkt betrachtet, sondern die von der Wärmepumpe erbrachte Arbeit (Leistung × Zeit) über ein ganzes Jahr.
Die Jahresarbeitszahl ist somit kein auf einem Prüfstand ermittelter Laborwert, sondern ein unter realen Bedingungen gemessener Wert. Sie gibt den verlässlichsten Aufschluss darüber, wie effizient eine Wärmepumpenanlage tatsächlich arbeitet.
Wenn man bildlich sprechen möchte:
- Der COP macht ein Foto (Momentaufnahme)
- Der SCOP macht mehrere Fotos (mehrere Momentaufnahmen)
- Die JAZ macht einen kompletten Film über ein ganzes Jahr
Ermittlung der Jahresarbeitszahl
Zur Ermittlung der Jahresarbeitszahl sind Stromzähler und Wärmemengenzähler erforderlich. Die Investition in entsprechende Zähleinrichtungen ist daher empfehlenswert, denn sie ermöglicht nicht nur die Bestimmung der erreichten Effizienz, sondern auch die frühzeitige Erkennung von Fehlern oder Defekten in der Anlage. Eine sich ohne erkennbaren Grund verschlechternde Jahresarbeitszahl kann ein Indikator für Probleme sein, die nicht sofort zur Abschaltung der Wärmepumpe führen, aber dennoch zu einem ineffizienten Betrieb beitragen.
Falls die Wärmepumpenanlage über einen elektrischen Heizstab verfügt, sollte auch dieser mit einem eigenen Stromzähler ausgestattet sein.
Einflussfaktoren auf die Jahresarbeitszahl
Zwischen der gemessenen Jahresarbeitszahl und den auf dem Prüfstand ermittelten COPs und SCOPs können teilweise erhebliche Unterschiede bestehen. Der Grund dafür ist, dass in der Praxis zahlreiche Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die auf dem Prüfstand nicht berücksichtigt werden.
Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Jahresarbeitszahl sind:
- Temperaturhub: Der Unterschied zwischen Quellentemperatur und Vorlauftemperatur bleibt der wichtigste Faktor
- Zusätzliche elektrische Verbraucher: Steuerungen, Umwälzpumpen, elektrischer Heizstab zum Nachheizen
- Anlagenkomponenten: Pufferspeicher und Trinkwarmwasserspeicher mit ihren Wärmeverlusten
- Nutzungsverhalten: Heizzeiten, Warmwasserbedarf, Raumtemperaturen
- Standortbedingungen: Lokale Witterungsverhältnisse, Aufstellort der Außeneinheit (bei Luftwärmepumpen)
- Installation und Hydraulik: Qualität der Installation, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Rohrleitungen
Bilanzierungsgrenzen für die Jahresarbeitszahl
Um eine Vergleichbarkeit bei der Berechnung von Jahresarbeitszahlen zu gewährleisten, wurden standardisierte Bilanzierungsgrenzen definiert. Es gibt insgesamt vier gängige Bilanzierungsgrenzen und damit auch vier unterschiedliche Arbeitszahlen:
| Bilanzierungsgrenze | Berücksichtigte Komponenten | Anwendungsbereich |
|---|---|---|
| 1 | Ausschließlich die Wärmepumpe selbst | Herstellerangaben, Laboruntersuchungen |
| 2 | Wärmepumpe und Wärmequelle (inkl. Solepumpe oder Ventilator) | Erweiterter Labortest |
| 3 | Wärmepumpe, Wärmequelle und elektrischer Heizstab | Bewertung der Wärmepumpenanlage, Vergleich mit konventionellen Heizsystemen |
| 4 | Vollständige Wärmepumpen-Heizungsanlage inklusive aller Umwälzpumpen | Gesamtsystembetrachtung, Energieberatung |
Für eine sinnvolle Bewertung der reinen Wärmepumpenanlage wird üblicherweise die Bilanzierungsgrenze 3 verwendet. Diese eignet sich auch gut für den Vergleich mit konventionellen Heizungssystemen, da bei Gas- oder Ölheizungen der Pumpenstrom (Bilanzierungsgrenze 4) üblicherweise ebenfalls nicht in die Verbrauchsbetrachtung einbezogen wird.
Die Jahresarbeitszahl nach Bilanzierungsgrenze 3 lässt sich jedoch nur ermitteln, wenn ein Wärmemengenzähler vorhanden und an der korrekten Stelle eingebaut ist. Viele moderne Wärmepumpen zeigen zwar Stromverbräuche und erzeugte Wärmemengen in ihrer Elektronik an, jedoch werden diese nicht mit physischen Wärmemengenzählern erfasst. Stattdessen verwenden Hersteller eigene Algorithmen, die aus verschiedenen Anlagenparametern die Wärmemenge berechnen. Diese theoretisch ermittelten Werte können um bis zu 10% von den tatsächlichen Werten abweichen und ersetzen keinen geeichten Wärmemengen- oder Stromzähler.
Berechnung der Jahresarbeitszahl
Ein wesentlicher Nachteil der Jahresarbeitszahl ist, dass sie erst ermittelt werden kann, wenn die Anlage bereits in Betrieb ist. In der Planungsphase lässt sich die Jahresarbeitszahl lediglich abschätzen.
Für diese Abschätzung gibt es ein genormtes Berechnungsverfahren nach VDI 4650, das folgende Faktoren berücksichtigt:
- Wärmepumpentyp
- Vor- und Rücklauftemperaturen (Temperaturhub)
- Warmwassermengen und deren Temperatur
- Betriebsweise der Anlage
Die mit dieser Methode ermittelten Jahresarbeitszahlen sind eine gute Entscheidungshilfe und eignen sich zum Vergleich unterschiedlicher Wärmepumpen-Anlagenkonzepte. Allerdings liegen die im Betrieb gemessenen tatsächlichen Jahresarbeitszahlen in der Regel niedriger als die berechneten Werte. Dies sollte bei der Planung einer Wärmepumpenanlage unbedingt berücksichtigt werden, um später nicht von unerwartet hohen Stromkosten überrascht zu werden.
Kühlen mit Wärmepumpen
Viele Wärmepumpen können nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Auch für die Kühlfunktion wird die Effizienz gemessen und geprüft. Das Pendant zum COP ist dabei das Energy Efficiency Rating (EER), und für den SCOP gibt es mit dem Seasonal Energy Efficiency Rating (SEER) ebenfalls ein entsprechendes Gegenstück.
Die Werte für EER und SEER liegen in der Regel deutlich höher als bei COP und SCOP. Für Klimasplitgeräte (Luft-Luft-Wärmepumpen) liegt der SEER laut Ergebnissen der Stiftung Warentest vom Juni 2024 im Mittel rund 60% höher als der SCOP. Wenn der SCOP beispielsweise bei 5,0 liegt, erreicht der SEER tendenziell einen Wert von etwa 8,0.
Diese höhere Effizienz beim Kühlen im Vergleich zum Heizen macht die Nutzung von Wärmepumpen zur Raumkühlung im Sommer besonders attraktiv. Hinzu kommt, dass genau dann, wenn es am heißesten ist, auch die meiste Photovoltaik-Energie zur Verfügung steht. PV-Strom und aktive Kühlung passen daher perfekt zusammen – auch dann, wenn man selbst keine PV-Anlage betreibt, da die Nutzung von Strom zur Kühlung im Sommer dazu beiträgt, Stromüberschüsse zu reduzieren und die Abschaltung von Windkraftanlagen zu vermeiden.
Die Vorteile der Kühlung mit Wärmepumpen sind:
- Hohe Effizienz: Der SEER liegt deutlich höher als der SCOP, was den Betrieb besonders wirtschaftlich macht
- Nutzung von PV-Überschüssen: Die höchste Kühlleistung wird genau dann benötigt, wenn die meiste PV-Energie zur Verfügung steht
- Netzstabilisierung: Die Nutzung von Strom zur Kühlung im Sommer trägt zur Vermeidung von Netzüberlastungen bei
- Komfortsteigerung: Eine Wärmepumpe bietet ganzjährigen Komfort – Heizen im Winter, Kühlen im Sommer
- Ökologischer Betrieb: Bei der Nutzung von PV-Strom ist die Kühlung nahezu CO₂-neutral möglich
Interessanterweise zeigen die Testergebnisse der Stiftung Warentest auch, dass Hersteller bei der Bewertung von SEER und SCOP durchaus optimistische Angaben machen. Die tatsächlich gemessenen Werte lagen bei allen untersuchten Anlagen mindestens 11% und maximal sogar 44% unter den Herstellerangaben. Im Mittel wurde ein Unterschied von etwa 20% festgestellt.
Fazit: Bescheid wissen ist Trumpf
Die Effizienz einer Wärmepumpe ist einer der wichtigsten Faktoren für ihre Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Um keine bösen Überraschungen bei den Betriebskosten zu erleben, ist es entscheidend, die verschiedenen Effizienzkennzahlen zu verstehen und richtig einzuordnen.
Während COP und SCOP gute Vergleichswerte für die Kaufentscheidung liefern, ist die tatsächlich erreichte Jahresarbeitszahl der maßgebliche Wert für die Bewertung der Anlage im realen Betrieb. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung des Temperaturhubs und aller relevanten Einflussfaktoren ist daher unerlässlich, um eine effiziente und wirtschaftliche Wärmepumpenanlage zu realisieren.
Wer sich für eine Wärmepumpe entscheidet, sollte daher in jedem Fall in die notwendige Messtechnik investieren, um die Jahresarbeitszahl kontinuierlich überwachen zu können. Nur so lässt sich die tatsächliche Effizienz der Anlage beurteilen und gegebenenfalls optimieren.
Letztes Update des Artikels: 2. April 2025